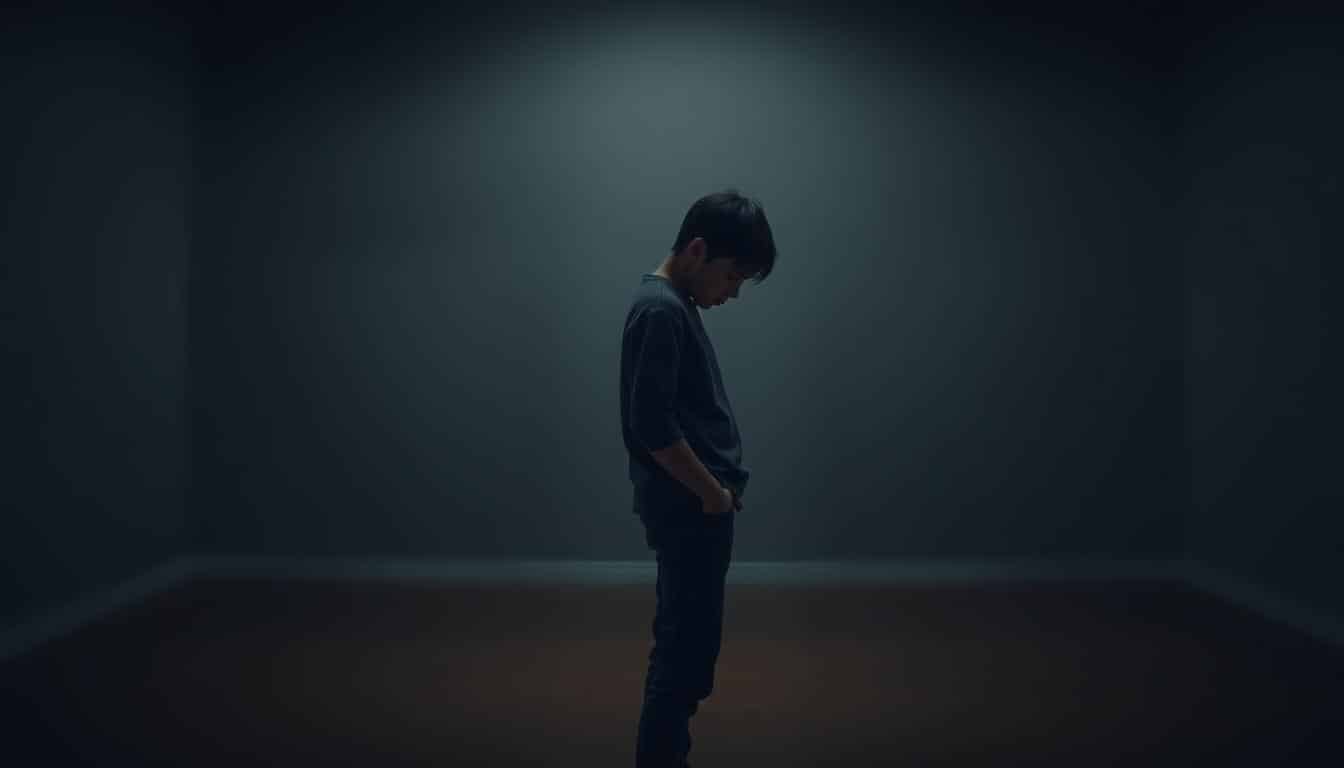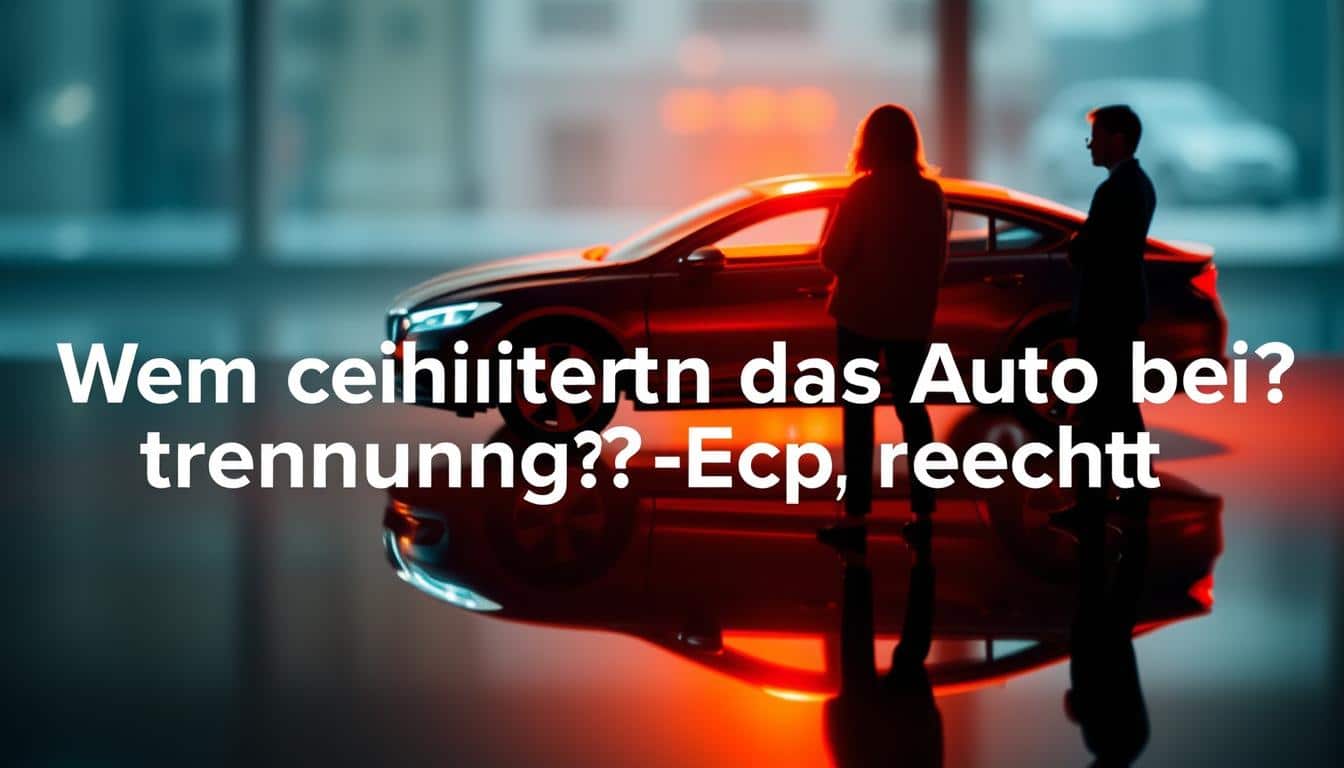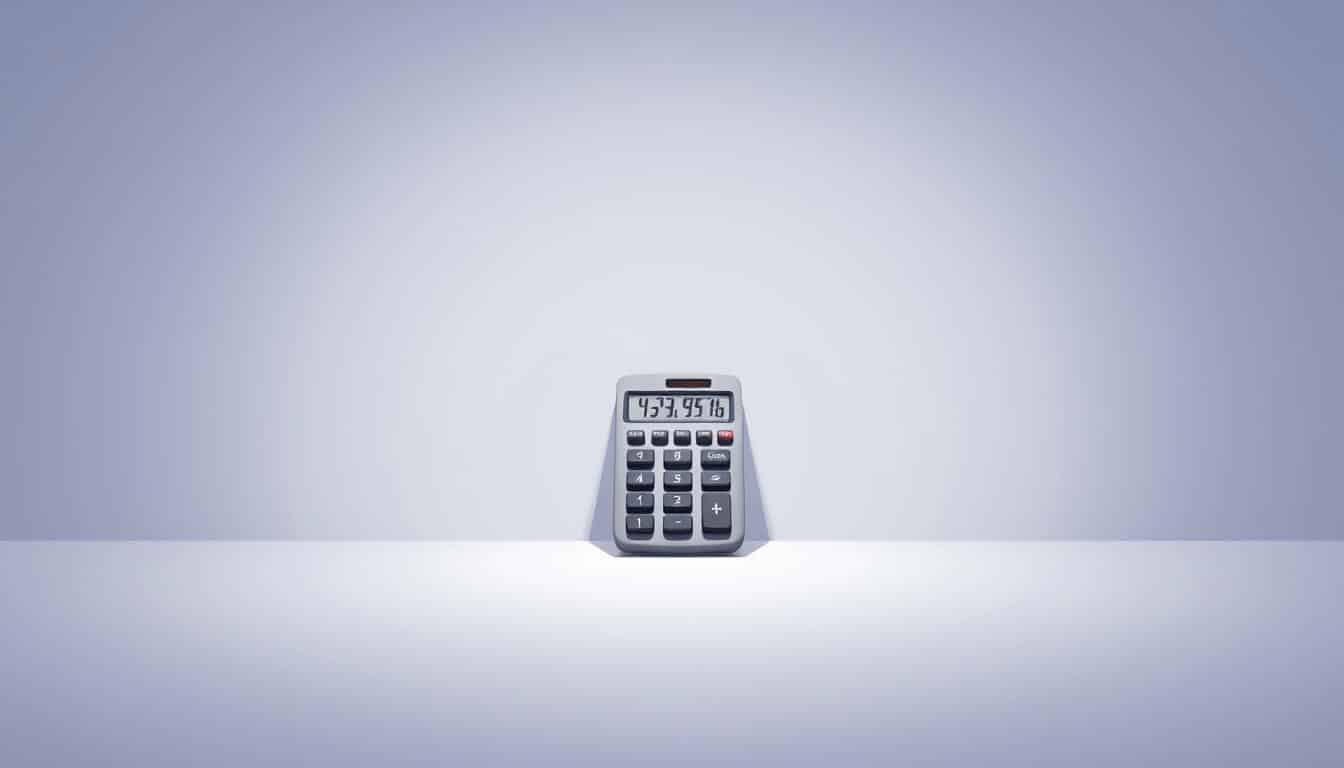In Deutschland ist die Unterhaltsdauer nach einer Scheidung ein komplexes Thema, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Diese Einführung bietet einen Überblick über die wichtigsten Aspekte des nachehelichen Unterhalts, einschließlich der Auswirkungen von Gesetzesreformen, der Ehedauer und persönlichen Umständen auf die Unterhaltsdauer. Da die gesetzlichen Bestimmungen stetigen Änderungen unterliegen, ist es wichtig, sich über die aktuellen Regelungen und die individuelle Situation genau zu informieren.
Das sind die Top beliebtesten Baby & Kinder Produkte
Einführung in den nachehelichen Unterhalt
Der nacheheliche Unterhalt ist eine finanzielle Unterstützung, die einem Ehepartner nach der Scheidung gewährt wird. Diese Absicherung spielt eine wesentliche Rolle, um den Lebensstandard des bedürftigen Partners zu sichern und ihm den Übergang in ein eigenständiges Leben zu erleichtern.
Definition und Bedeutung
Die Bedeutung des Unterhalts liegt darin, den wirtschaftlichen Nachteil, der durch die Ehe und deren Beendigung entsteht, abzumildern. Der nacheheliche Unterhalt kann in unterschiedlichen Formen, wie Geldzahlungen oder Naturalunterhalt, gewährt werden und dient dazu, das vorherige Lebensniveau zu erhalten.
Gesetzliche Grundlagen
Die gesetzliche Regelung des nachehelichen Unterhalts ist in verschiedenen Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) festgeschrieben. Zu diesen Regelungen gehören unter anderem der § 1570 für den Betreuungsunterhalt, der § 1572 für Unterhalt wegen Krankheit und der § 1571 für Unterhalt wegen Alters. Diese Paragraphen definieren die Bedingungen und Rahmen für nachehelicher Unterhalt.
Faktoren für die Unterhaltsdauer
Die Dauer des nachehelichen Unterhalts hängt von mehreren Faktoren ab. Hierzu zählen die Bedürftigkeit des unterhaltsberechtigten Ehepartners, die Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen Partners sowie besondere Umstände wie Kinderbetreuung oder Krankheit. Die Bedeutung des Unterhalts kann unter anderem durch die Länge der Ehe und die Lebensumstände der Beteiligten beeinflusst werden.
Trennungsunterhalt vs. nachehelicher Unterhalt
Der Trennungsunterhalt und der nacheheliche Unterhalt sind zwei unterschiedliche Formen finanzieller Unterstützung, die im Rahmen einer Ehe und deren Auflösung gewährt werden. Ein zentraler Unterschied nachehelicher Unterhalt besteht darin, dass Trennungsunterhalt für den Zeitraum der Trennung, aber vor der endgültigen Scheidung gewährt wird. Im Gegensatz dazu beginnt der nacheheliche Unterhalt erst nach der Scheidung.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Trennungsunterhalt und nachehelichem Unterhalt liegt also im Zeitpunkt der Gewährung. Der Trennungsunterhalt setzt voraus, dass die Ehepartner getrennt leben, während der nacheheliche Unterhalt erst nach der Scheidung zu zahlen ist. Beide Arten des Unterhalts sollen jedoch sicherstellen, dass der finanziell schwächere Partner während und nach der Ehe nicht in wirtschaftliche Not gerät. In beiden Fällen spielt die Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten eine zentrale Rolle.
Rechtliche Bestimmungen
Die rechtlichen Grundlagen für Trennungsunterhalt sind im § 1361 BGB festgelegt, während der nacheheliche Unterhalt nach der Scheidung durch andere Bestimmungen geregelt wird. Ein wichtiger Unterschied nachehelicher Unterhalt ist, dass der Trennungsunterhalt in der Regel nur für die Dauer der Trennung gezahlt wird und endet, wenn die Scheidung rechtskräftig wird. Der nacheheliche Unterhalt tritt dann in Kraft und kann je nach individuellen Umständen zeitweise oder unbefristet gewährt werden. Es ist wichtig, die jeweiligen rechtlichen Anforderungen und Voraussetzungen zu kennen, um die Ansprüche korrekt zu verstehen und geltend zu machen.
Dauer des Trennungsunterhalts
Die Dauer des Trennungsunterhalts ist ein wichtiger Aspekt im deutschen Familienrecht. Dieser wird durch gesetzliche Regelungen bestimmt und kann in bestimmten Fällen verlängert werden.
Gesetzliche Regelung nach § 1361 BGB
Der Trennungsunterhalt ist gemäß § 1361 BGB geregelt und gewährt dem wirtschaftlich schwächeren Ehegatten während der Trennungsphase Unterstützung. Diese Unterstützung dauert in der Regel bis zur rechtskräftigen Scheidung an. § 1361 BGB legt fest, dass die finanzielle Absicherung für den Zeitraum der Trennung sicherzustellen ist, wobei die Höhe des Unterhalts von den jeweiligen Einkommensverhältnissen abhängig ist.
Verlängerung über das Trennungsjahr hinaus
Obwohl die Dauer des Trennungsunterhalts prinzipiell beschränkt ist, kann es zu einer Verlängerung über das Trennungsjahr hinaus kommen. Solche Verlängerungen sind vor allem dann möglich, wenn Verzögerungen im Scheidungsprozess auftreten oder besondere Umstände dies rechtfertigen. In der Praxis kommt es häufig vor, dass sich der Scheidungsprozess länger hinzieht, was eine entsprechende Anpassung der Unterhaltszahlungen notwendig macht. Die Dauer des Trennungsunterhalts kann in solchen Fällen flexibel gehandhabt werden, um den Bedürfnissen beider Parteien gerecht zu werden.
Die gesetzliche Grundlage für diese Regelungen ist eindeutig in § 1361 BGB verankert, welcher die Rahmenbedingungen für die finanzielle Unterstützung während der Trennungsphase definiert. Diese gesetzlichen Bestimmungen sind darauf ausgelegt, eine faire und gerechte Behandlung beider Ehegatten sicherzustellen.
Unterhalt wegen Kinderbetreuung
Der Unterhalt Kinderbetreuung ist eine wichtige Unterstützung für alleinerziehende Elternteile. Dieser Unterhalt wird in der Regel für Kinder unter drei Jahren gewährt, um sicherzustellen, dass der betreuende Elternteil die bestmögliche Versorgung leisten kann.
Grundsätzliche Dauer des Betreuungsunterhalts
Die grundsätzliche Dauer des Betreuungsunterhalts erstreckt sich bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. In dieser Zeit soll der betreuende Elternteil den Fokus auf die Versorgung und Erziehung des Kindes legen können. Die genaue Dauer kann anhand der individuellen Bedürfnisse des Kindes und der Betreuungsmöglichkeiten variieren.
Verlängerungen und Sonderfälle
Unter bestimmten Bedingungen kann eine Verlängerung Betreuungsunterhalt über das dritte Lebensjahr hinaus notwendig sein. Beispielsweise, wenn es eingeschränkte Betreuungsmöglichkeiten gibt oder das Kind besondere Bedürfnisse hat, die eine intensivere Betreuung erfordern. Zudem können gesundheitliche Aspekte des betreuenden Elternteils zu einer Verlängerung führen.
Nachehelicher Unterhalt bei Krankheit und Gebrechen
Nachehelicher Unterhalt bei Krankheit und Gebrechen ist ein wichtiges Thema, das differenziert betrachtet werden muss. Abhängig von der Erkrankung und den spezifischen Umständen des betroffenen Partners kann die Dauer und Höhe des Unterhalts variieren. Die gesetzlichen Regelungen bieten hier einen Rahmen, der individuell angepasst werden muss.
Dauer und Bedingungen
Unterhalt bei Krankheit oder Gebrechen wird je nach Schwere und Dauer der Erkrankung gewährt. Ein zentraler Faktor ist hierbei die Bedürftigkeit des Ex-Partners sowie seine Fähigkeit, sich selbst zu versorgen. In Fällen chronischer oder langfristiger Krankheiten kann der Unterhalt auf unbestimmte Zeit gewährt werden, bis eine wesentliche Änderung der Umstände eintritt.
Genesung und Änderungen der Zahlungspflicht
Änderungen Unterhaltspflicht können bei einer Verbesserung des Gesundheitszustandes des Unterhaltsberechtigten erfolgen. Sollte eine Genesung eintreten oder sich die Fähigkeit zur selbstständigen Lebensführung verbessern, kann eine Anpassung oder sogar Beendigung des Unterhaltsanspruchs notwendig werden. Diese Anpassungen müssen jedoch immer im Einzelfall geprüft und gegebenenfalls gerichtlich bestätigt werden, um die Interessen beider Parteien zu wahren.
Nachehelicher Unterhalt wegen Alters
Der nacheheliche Unterhalt wegen Alters spielt in vielen Scheidungsfällen eine wesentliche Rolle und richtet sich stark nach der individuellen Erwerbsfähigkeit des Unterhaltsberechtigten. Durch besondere gesetzliche Regelungen wird sichergestellt, dass Personen im Alter nicht in finanzielle Not geraten.
Rahmenbedingungen nach § 1571 BGB
Gemäß § 1571 BGB besteht ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt wegen Alter immer dann, wenn es dem unterhaltsberechtigten Ex-Ehepartner aufgrund von einmaligem Alter nicht mehr zuzumuten ist, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Dabei wird nicht nur das tatsächliche Alter, sondern auch die aktuelle gesundheitliche und wirtschaftliche Situation des Unterhaltsberechtigten berücksichtigt.
Sonderregelungen für Rentner
Für Rentner gibt es besondere Regelungen im Familienrecht. Wenn der Rentenbeginn erreicht ist und der Rentenanspruch nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu decken, kann der unterhaltspflichtige Ex-Ehepartner zur Zahlung von Unterhalt verpflichtet werden. Diese Zahlungen können unter bestimmten Voraussetzungen auch lebenslang fortbestehen, insbesondere wenn der Unterhaltsanspruch schon während der Erwerbsphasen bestand und die Renteneinkünfte nicht ausreichen.
Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit
Der Unterhalt bei Erwerbslosigkeit stellt sicher, dass ein wirtschaftlich schwächerer Ehegatte nach der Scheidung finanziell abgesichert ist. Diese Art der Unterstützung wird gewährt, bis der betroffene Ehegatte eine angemessene Beschäftigung findet und eigenständig für seinen Lebensunterhalt sorgen kann.
Zeitrahmen und Prognosen
Der Zeitraum, in dem der Unterhalt bei Erwerbslosigkeit gezahlt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind unter anderem die Dauer der Ehe, das Alter und die beruflichen Aussichten des Unterhaltsberechtigten. Oftmals wird eine Prognose erstellt, um die voraussichtliche Dauer der Unterstützung abzuschätzen.
Verlängerung bei unvorhersehbaren Ereignissen
Unvorhersehbare Ereignisse wie unerwarteter Jobverlust, gesundheitliche Probleme oder wirtschaftliche Krisen können eine Verlängerung der Unterhaltsdauer rechtfertigen. In solchen Fällen ist eine erneute Prüfung notwendig, um den fortbestehenden Unterhaltsanspruch zu beurteilen und entsprechend anzupassen. Diese Verlängerung Unterhaltsdauer ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Unterhaltsberechtigte nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerät.
Wie lange Unterhalt nach Scheidung?
Nach der Unterhaltsreform von 2008 wurden wesentliche Änderungen eingeführt, die die Dauer des Unterhalts nach Scheidung beeinflussen. Diese Reform zielte darauf ab, die Eigenverantwortung der geschiedenen Ehepartner zu stärken und die Befristung von Unterhaltsansprüchen häufiger anzuwenden.

Grundsätze der Unterhaltsreform von 2008
Die Reform von 2008 stellt klar, dass die Befristung Unterhaltsansprüche vermehrt in den Fokus rückt. Diese Reform hat zum Ziel, beide Partner nach einer Scheidung zu befähigen, finanziell unabhängig zu werden. Dadurch wird der Unterhalt nach Scheidung oft nur für einen begrenzten Zeitraum gewährt, es sei denn, besondere Umstände erfordern eine längere Zahlung.
Unbefristete und befristete Unterhaltsansprüche
Grundsätzlich wird der Unterhalt nach Scheidung heute häufiger befristet als unbefristet gewährt. Die Befristung Unterhaltsansprüche hängt davon ab, wie lange die Ehe gedauert hat, ob Kinder betreut werden müssen, und inwiefern einer der Partner bedürftig ist oder nicht. Unbefristete Unterhaltszahlungen werden meist nur noch in Ausnahmefällen zugesprochen, etwa bei langen Ehen oder wesentlichen Einschränkungen aufgrund von Alter oder Krankheit.
Zeitliche Beschränkung des nachehelichen Unterhalts
Die zeitliche Beschränkung des nachehelichen Unterhalts ist ein komplexes Thema, das gesetzliche Vorgaben und gerichtliche Praxis erfordert. Bei der Beschränkung Unterhaltsdauer werden verschiedene Faktoren wie die Dauer der Ehe, die finanzielle Situation und die Lebensverhältnisse berücksichtigt. Es ist entscheidend, individuelle Umstände wie die Wiedereingliederung des unterhaltsberechtigten Ehepartners in den Arbeitsmarkt zu prüfen.
Generell gilt, dass der Unterhalt so zu begrenzen ist, dass alle Parteien möglichst schnell in die Lage versetzt werden, eigenständig für sich sorgen zu können. Dies wird durch eine genaue Prüfung der Umstände und die Anwendung der gesetzlichen Regelungen erreicht. Die Beschränkung Unterhaltsdauer kann durch gerichtliche Entscheidungen, je nach Einzelfall, unterschiedliche Zeiträume betreffen.
Wichtige Faktoren, die zur Beschränkung Unterhaltsdauer beitragen, sind neben der Ehedauer die Eingliederung in den Arbeitsmarkt, die Betreuung gemeinsamer Kinder und die wirtschaftlichen Verhältnisse beider Parteien. Die Gesetzgebung sieht vor, dass die Dauer der nachehelichen Unterhaltszahlungen soweit wie möglich verkürzt wird, um beide Ehepartner zu ermutigen, nach der Scheidung finanziell unabhängig zu werden.
Die Beschränkung Unterhaltsdauer muss stets fair und angemessen sein, um sowohl den zahlungspflichtigen als auch den unterhaltsberechtigten Ehepartner zu schützen und eine gerechte Lösung zu ermöglichen. Hierbei spielen die individuellen Gegebenheiten und die Zukunftsperspektiven der betroffenen Personen eine zentrale Rolle.
Das sind die neuesten Baby & Kinder Produkte
Einfluss der Ehedauer auf den Unterhaltsanspruch
Die Ehedauer spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Dauer des Unterhaltsanspruchs. Es ist unerlässlich, unterschiedliche Aspekte im Zusammenhang mit der Länge der Ehe zu analysieren, um den maßgeblichen Einfluss auf den Unterhalt zu verstehen.
Kurzfristige Ehen
Bei kurzfristigen Ehen, die nur wenige Jahre andauern, wird der Unterhaltsanspruch häufig befristet. Das Ziel dieser Regelung ist es, den wirtschaftlichen Ausgleich nur für eine begrenzte Zeit zu ermöglichen, da die wirtschaftliche Verflechtung in solchen Fällen geringer ausfällt. Die Ehedauer ist somit ein kritischer Faktor für die Ausgestaltung des Unterhalts.
Längerfristige Ehen
Dagegen führen längerfristige Ehen oft zu umfassenderen Unterhaltsansprüchen. In solchen Ehen haben beide Partner in der Regel eine langfristige wirtschaftliche und soziale Bindung aufgebaut, die nach der Scheidung eine längere Unterhaltszahlung notwendig macht. Die Ehedauer beeinflusst direkt die Höhe und die Dauer des Unterhaltsanspruchs und dient als maßgebliches Kriterium bei der Entscheidung von Gerichten.
Verhalten des Unterhaltsberechtigten und Auswirkungen
Das Verhalten Unterhaltsberechtigte kann maßgeblich die Höhe und Dauer des Unterhalts beeinflussen. Verschiedene Szenarien können dabei unterschiedliche Folgen haben, die es zu beachten gilt.
Neue Partnerschaften und Lebensgemeinschaften
Das eingehen einer neuen Partnerschaft oder Lebensgemeinschaft durch den Unterhaltsberechtigten kann direkte Auswirkungen auf den Unterhalt haben. Eine neue eheähnliche Gemeinschaft führt oft zur Kürzung oder sogar zur kompletten Einstellung des Unterhaltsanspruchs.
Mutwillige Bedürftigkeit
Wenn der Unterhaltsberechtigte mutwillig seine Bedürftigkeit herbeiführt oder aufrechterhält, kann dies ebenfalls Auswirkungen auf den Unterhalt haben. Gerichte prüfen regelmäßig, ob die Bedürftigkeit absichtlich herbeigeführt wurde und passen den Unterhalt entsprechend an.
Schweres Fehlverhalten
Schweres Fehlverhalten des Unterhaltsberechtigten kann dazu führen, dass der Unterhaltsanspruch reduziert oder vollständig entfällt. Ein gravierendes Fehlverhalten, wie etwa Straftaten gegenüber dem Unterhaltspflichtigen, kann eine erhebliche Rolle bei der Anpassung des Unterhalts spielen.
Individuelle Vereinbarungen zum nachehelichen Unterhalt
In Deutschland besteht die Möglichkeit, dass Ex-Partner individuelle Unterhaltsvereinbarungen treffen, um den nachehelichen Unterhalt an ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse anzupassen. Diese Vereinbarungen können besonders sinnvoll sein, wenn eine flexible Anpassung des Unterhalts gewünscht wird oder wenn beide Parteien eine einvernehmliche Lösung anstreben.
Eine notarielle Beurkundung solcher Vereinbarungen ist essenziell, damit sie rechtlich bindend und vollstreckbar sind. Notare stellen sicher, dass die Unterhaltsvereinbarungen im Einklang mit den geltenden Gesetzen stehen und alle juristischen Anforderungen erfüllt werden. Durch eine notarielle Beurkundung wird auch verhindert, dass spätere Anfechtungen einfacher durchgesetzt werden können.
Es ist wichtig, regelmäßige Überprüfungen der Vereinbarungen vorzunehmen, um mögliche Änderungen der Lebensumstände zu berücksichtigen. Die Anpassung Unterhalt kann notwendig werden, wenn zum Beispiel die Einkommensverhältnisse eines Ex-Partners sich erheblich ändern oder unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Eine flexible und individuelle Lösung ermöglicht eine gerechte Aufteilung der finanziellen Verpflichtungen nach einer Scheidung.
FAQ
Was ist der Unterschied zwischen Trennungsunterhalt und nachehelichem Unterhalt?
Trennungsunterhalt wird während der Trennungsphase bis zur rechtskräftigen Scheidung gewährt, während der nacheheliche Unterhalt erst nach der Scheidung zur Sicherung des Lebensstandards des weniger verdienenden Ehegatten dient.
Auf welchen gesetzlichen Grundlagen basiert der Unterhalt nach Scheidung in Deutschland?
Die gesetzlichen Grundlagen für den Unterhalt nach der Scheidung sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), insbesondere in den §§ 1569-1586b BGB, zu finden.
Welche Faktoren beeinflussen die Dauer des nachehelichen Unterhalts?
Die Dauer des nachehelichen Unterhalts wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Dauer der Ehe, das Alter und die Erwerbsfähigkeit der Ehegatten, sowie die Betreuung gemeinsamer Kinder.
Welche gesetzliche Regelungen gelten für den Trennungsunterhalt gemäß § 1361 BGB?
§ 1361 BGB legt fest, dass der besserverdienende Ehegatte dem anderen Trennungsunterhalt gewähren muss, sofern dieser den bisherigen ehelichen Standard nicht selbstständig aufrechterhalten kann.
Unter welchen Umständen kann der Trennungsunterhalt über das Trennungsjahr hinaus verlängert werden?
Der Trennungsunterhalt kann über das Trennungsjahr hinaus verlängert werden, wenn die Scheidung sich verzögert oder wenn besondere Umstände wie Pflegebedürftigkeit oder Krankheit vorliegen.
Wie lange dauert der Unterhalt wegen Kinderbetreuung grundsätzlich?
Der Betreuungsunterhalt wird in der Regel bis zum dritten Lebensjahr des Kindes gewährt. In bestimmten Fällen kann der Unterhalt jedoch verlängert werden, beispielsweise wenn die Kinderbetreuung nicht anderweitig sichergestellt werden kann.
Welche Dauer und Bedingungen gelten für den nachehelichen Unterhalt bei Krankheit und Gebrechen?
Der nacheheliche Unterhalt bei Krankheit und Gebrechen richtet sich nach der Schwere und Dauer der Beeinträchtigung. Die Zahlungspflicht kann modifiziert werden, wenn sich der Gesundheitszustand des Unterhaltsberechtigten bessert.
Welche Rahmenbedingungen gelten nach § 1571 BGB für den nachehelichen Unterhalt wegen Alters?
§ 1571 BGB legt fest, dass ein nachehelicher Unterhalt bei Erreichen eines bestimmten Alters oder bei Eintritt in den Ruhestand gewährt wird, wenn eine Erwerbsarbeit nicht mehr zugemutet werden kann.
Welche Sonderregelungen gelten für Rentner hinsichtlich des nachehelichen Unterhalts?
Für Rentner gelten spezielle Regelungen, die darauf abzielen, dass der nacheheliche Unterhalt anhand der Rentenansprüche und der individuellen finanziellen Situation angepasst wird.
Wie sind die Zeitrahmen und Prognosen für Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit?
Die Dauer des Unterhalts wegen Erwerbslosigkeit hängt von den konkreten Umständen ab, wie der Dauer und der Ursache der Erwerbslosigkeit sowie den beruflichen Möglichkeiten des Unterhaltsberechtigten.
Kann der Unterhalt bei unvorhersehbaren Ereignissen verlängert werden?
Ja, der Unterhalt kann verlängert werden, wenn unvorhersehbare und erhebliche Ereignisse wie schwere Krankheit oder erheblicher Einkommensverlust eintreten.
Welche Prinzipien folgen der Unterhaltsreform von 2008?
Die Unterhaltsreform von 2008 sieht die stärkere Förderung der Eigenverantwortung vor und beschränkt den nachehelichen Unterhalt auf das notwendige Maß, um die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Ehegatten zu fördern.
Welche Unterschiede gibt es zwischen unbefristeten und befristeten Unterhaltsansprüchen?
Unbefristete Unterhaltsansprüche bestehen oft bei langjährigen Ehen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder höheren Alters. Befristete Ansprüche sind eher bei kürzeren Ehen und Situationen, in denen eine wirtschaftliche Wiedereingliederung erwartet wird, gegeben.
Wie beeinflusst die Ehedauer den Unterhaltsanspruch?
Kurzfristige Ehen führen häufiger zu befristeten Unterhaltsansprüchen, während bei langfristigen Ehen oft unbefristete Ansprüche gewährt werden, da eine wirtschaftliche Verflechtung der Ehegatten vorausgesetzt wird.
Welche Folgen haben neue Partnerschaften oder Lebensgemeinschaften auf den Unterhaltsanspruch?
Neue Partnerschaften oder Lebensgemeinschaften können den Unterhaltsanspruch mindern oder beenden, da davon ausgegangen wird, dass der Unterhaltsberechtigte nun eine gemeinsame Wirtschaftsgemeinschaft mit dem neuen Partner führt.
Was geschieht bei mutwilliger Bedürftigkeit?
Mutwillige Bedürftigkeit, wie das absichtliche Vermeiden von Arbeit, kann zur Kürzung oder vollständigen Streichung des Unterhaltsanspruchs führen.
Wie wirkt sich schweres Fehlverhalten auf den Unterhaltsanspruch aus?
Schweres Fehlverhalten des Unterhaltsberechtigten, beispielsweise schwerwiegende Straftaten gegenüber dem Unterhaltsverpflichteten, kann dazu führen, dass der Unterhaltsanspruch reduziert oder gänzlich aberkannt wird.
Können individuelle Vereinbarungen zum nachehelichen Unterhalt getroffen werden?
Ja, Ehegatten können individuelle Vereinbarungen zum nachehelichen Unterhalt treffen, die in einem Ehevertrag festgehalten und notariell beglaubigt werden sollten, um rechtswirksam zu sein.